|
Wellenreiter-Kolumne vom 21. November 2012
Die Zukunft in der Glaskugel
"Die Zukunft hat
viele Namen: Für
Schwache ist sie das
Unerreichbare,
für die Furchtsamen das
Unbekannte, für die Mutigen die
Chance"
(Victor Hugo)
Das kurze Zeitalter der "New
Economy" (1995 bis 2000) war eine mutige Zeit. Der Glaube an den
unbegrenzten Horizont der Zukunft war groß. Alles schien möglich. Man
sagt, die New Economy sei gescheitert. Das ist nicht wahr. Dieses
Zeitalter legte den Grundstein für zwei maßgebliche Entwicklungen.
Einerseits breitete sich das Internet wie eine Krake über die Welt aus.
Andererseits entwickelte sich eine Mobiltelefonie, die ihren - vorläufigen
- Höhepunkt in der Entwicklung von Smartphones fand.
Eine Vielzahl von
New-Economy-Unternehmen scheiterten oder blieben in ihrer Bedeutung
zurück. Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon.com und Apple nutzten
ihre Chance. Ob im "Eisenbahnrausch" vor 150 Jahren oder im "Autorausch"
vor 100 Jahren: Auch damals blieben nur wenige Gewinner übrig.
Jetzt - gegen Ende des Jahres
2012 - überwiegen die Furchtsamen. Der DAX steigt um 20 Prozent. Noch vor
einigen Jahren hätte es dafür Jubelarien in der Presse gegeben. Jetzt:
Nichts. Die meisten Anleger - sofern es sie noch gibt - reagieren
unbeeindruckt. Hauptsache, das Geld liegt sicher auf dem Tagesgeldkonto,
steckt in einer neuen Immobilie oder befindet sich in Form einer Anleihe
beim Staat. Rendite ist "wurscht". Die Angst vor der Schuldenproblematik
lähmt.
Während die Mutigen in der
Zukunft ihre Chance sehen und die Furchtsamen negativ in die Zukunft
blicken, haben die "Schwachen" nicht das Gefühl, eine Zukunft zu haben.
Sie haben resigniert. Oder sie weichen aus. Von Griechenland nach
Australien, von Portugal nach Brasilien, von Spanien in andere Teile
Südamerikas. Oder jeweils nach Deutschland. Juan Carlos, der König des
einstmals so stolzen Kolonialreiches, schickte jüngst einen Hilferuf an
die Adresse südamerikanischer Staaten. Man möge bitte helfen, Spaniens
Wirtschaft zu retten.
Jeder Leser mag sich selbst
testen, welcher Gruppierung er sich angehörig fühlt.
Wie wird sie denn nun, die
Zukunft?
Anti-Tech? Wohl nicht. Das
Technologie-Momentum, welches zwischen 1995 und 2000 einen Schub erhalten
hat, dürfte anhalten und uns möglicherweise selbstfahrende Autos, eine
autonomere Energieversorgung und eine Weiterentwicklung der
Smartphone-Kultur bringen.
Kriegerisch? Eine derart lange
Friedensphase wie von 1945 bis heute ist für Kern-Europa historisch
betrachtet selten. Die Europäische Union sollte in der Lage sein, den
Friedenszustand zu erhalten. Die USA dürften mittelfristig das Interesse
am Nahen Osten verlieren. Die wachsende eigene Ölproduktion macht es
möglich. China dürfte in den kommenden Jahren nicht davor zurückschrecken,
seine Einflusssphäre zu verteidigen bzw. auszuweiten. Nach 20 Jahren
unbändigen Wachstums sind die Backen aufgeblasen. Japan ist der
langfristige Verlierer in Asien.
Betrachtet man die Liste für
Kriegsgründe, so spielt das Streben nach wirtschaftlichen Vorteilen eine
entscheidende Rolle. Religiöse, politische oder ideologische Gründe
verbergen sich häufig dahinter, auch wenn Kriegsgründe natürlich
vielschichtig sind. Von einem Krieg hätte China wirtschaftliche Nachteile
zu befürchten. Aus diesem Grund gelten angeschlagene Länder als
kriegsbereiter.
Müssen wir Angst vor der
Zukunft haben?
Eine der größten
Errungenschaften der industriellen Revolution und deren Folgen war die
Ausweitung des "Mittelstandsbauchs". Eine ähnliche Entwicklung erfolgt
derzeit in China und andere asiatischen Wachstumsregionen. Die Besitzlosen
werden zu Besitzenden. Ein großer Mittelstand bei nur noch geringen
Wachstumsraten (alte Industriestaaten) bedeutet eine steigende Anzahl an
Menschen, die unter Verlustängsten leiden Angst löst Aktionen aus (z.B.
den Kauf von Gold, von Versicherungen etc). Man investiert in einen
Schutzpanzer. Rüstungsausgaben waren schon immer kostspielig und binden
Kapital, dass anderswo als Investment arbeiten könnte. Das
unterschiedliche Sentiment in den alten Industriestaaten einerseits und in
den aufstrebenden Wachstumsregionen andererseits dürfte vorerst erhalten
bleiben. Vielleicht sollten wir Europäer einfach lernen, mit der Angst zu
leben, die bei geringen oder negativen Wachstumsraten automatisch
auftritt. Das Wort "Zuversicht" wird immer seltener - zu selten - benutzt.
Wie entwickelt sich die Börse?
Die Zukunft ist nicht
vorhersehbar, das gilt auch für die Börse. Und doch liefern historische
Verläufe Anhaltspunkte. So verlief das Jahr
2012 in
den ersten drei Quartalen börsentechnisch wie ein normales US-Wahljahr.
Eine gravierende Abweichung ergab sich erst im November (folgender Chart).
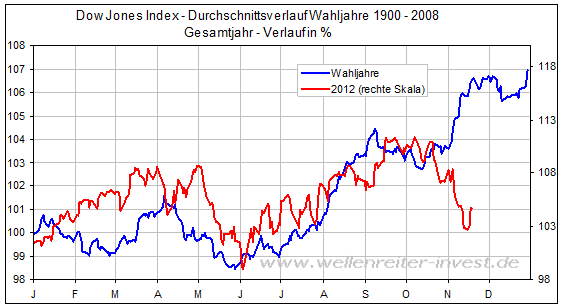
Wir können auf eine mehr als
200jährige Verlaufsgeschichte des Dow Jones Index zurückblicken (vor 1896
zurückgerechnet). In dieser Geschichte kam es immer mal wieder vor, dass
Dekaden ähnlich verliefen. So z.B. die Dekade der 1900er Jahre und die
Dekade der 1970er Jahre.
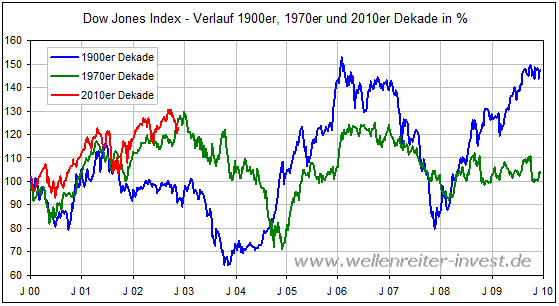
Ob nun die 2010er Dekade dem
dargestellten Muster folgt, sei dahingestellt. Aber es dürfte eine grobe
Orientierung sein. Als Erfahrungswert lässt sich sagen, dass die zweite
Hälfte einer Dekade gegenüber der ersten Hälfte meist besser läuft.
US-Rezessionen treten gehäuft zu Beginn einer Dekade auf. Wir gehen davon
aus, dass die Aktienmärkte - und sei es nach einem zähen Jahr 2013 - die
Chance haben, in eine Aufwärtsbewegung überzugehen, die den nunmehr 12
Jahre alten Bärenmarkt hinter sich lassen sollte. Antizipieren Sie die
Entwicklung der Finanzmärkte mit Hilfe unserer handelstäglichen
Frühausgabe.
Robert Rethfeld
Wellenreiter-Invest
P.S. Ein kostenloses 14tägiges Schnupperabonnement erhalten Sie unter
www.wellenreiter-invest.de
|
